Semesterprogramm WiSe 25/26
Bachelor-Thesis / Master
15-92-6411 / 15-02-7400
Problemstellung
Die Bauindustrie verbraucht enorme Massen an Ressourcen – und erzeugt zugleich viel mineralischen Bauschutt, der heute im besten Fall über Downcycling in neue mineralische Produkte überführt wird, häufig aber noch auf Deponien landet. Gerade die Nicht-Standard-Geometrien und die Heterogenität des Bauschutts machen die direkte Wiederverwendung schwierig: industrielle Prozesse, Normen und Planungstools sind auf standardisierte Produkte ausgelegt. Gleichzeitig bergen diese Materialien aber ästhetische Potenziale – sichtbare Materialbiografien sowie dem Material innewohnende, freilegbare Texturen und Qualitäten –, die, präzise gestaltet, die soziale Akzeptanz einer Architektur der Wiederverwendung erhöhen können.
Struktur des Entwurfs
Zu Beginn arbeiten die Studierenden in Kleingruppen prototypisch mit State-of-the-Art-Forschungsprojekten und ordnen diese entlang dreier Strategien: Addieren (etwas hinzufügen, z. B. maßgeschneiderte Verbinder), Subtrahieren (bearbeiten und fügen, z. B. sägen/fräsen/meißeln), Ordnen (unveränderte Elemente neu arrangieren). Aus der Reflexion dieser Prototypen entwickeln die Studierenden eigene Forschungsfragen, die im Semester in den Entwurf einer Konstruktionsmethode münden – samt architektonischem Szenario.
Hands-on & Nähe zum Material
Der Entwurf ist materialnah und experimentell: Scannen, Katalogisieren, Prototyping im Maßstab bis 1:1. Lernen durch Machen verbindet digitale Strategien (Rhino/Grasshopper, Photogrammetrie, Datenmodelle) mit materialgerechter Konstruktion. Ziel ist eine reflektierte, nachhaltige Architekturpraxis, die robuste, reversible Lösungen erprobt – und zeigt, dass aus irregulärem Bauschutt räumliche, konstruktive und ästhetische Qualität werden kann.
Zeit: Mi, 14:00 – 18:00 h
Erstes Treffen: 15.10.2025
Ort: L3/01 EG Raum 51 (Fachbereichssaal)
Kontakt: Oliver Tessmann / Sandro Siefert
Sprache: Deutsch/Englisch


B433 (ehemals B322 – Gestalten mit Medien)
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die wichtigsten digitalen Werkzeuge und Methoden sowie deren Anwendung beim Entwerfen, Darstellen und im Modellbauen. Es werden Beispiele zur effektiven Nutzung digitaler Prozesse und Schnittstellen im Entwurf und Gestaltung diskutiert. Ein besonderer Fokus wird auf das Erlernen von Prozessen gerichtet: Wie greifen verschiedene Werkzeuge ineinander? Welche Schnittstellen gibt es zwischen ihnen? Welchen Einfluss hat das Werkzeug auf das Entwurfsergebnis? Wie können die zeitgenössischen digitalen Werkzeuge und Methoden historisch verortet werden?
In der Übung erlernen Teilnehmer:innen, Zeichnungen und 3D-Modelle zu erstellen, axonometrische und perspektivische Vektorgrafiken aus 3D-Modellen abzuleiten und illustrativ zu bearbeiten, Prinzipien des parametrischen Entwerfens sowie Datenaufbereitung für den Modellbau mittels digitaler Fabrikation (3D-Druck und Laserschneiden). Das Modul befähigt Teilnehmer:innen somit, Digitale Prozesse und Schnittstellen in Entwurf und Gestaltung effektiv zu nutzen.
Zeit: Di, 09:50 – 11:35h – Vorlesung / Di 11:40 – 13:20h – Übung
Erstes Treffen: 14.10.2025
Ort: Vorlesung L3|01 / 93 (Übung online)
Kontakt: Oliver Tessmann / Max Eschenbach
Sprache: Deutsch


Bachelor / Master
15-01-6466 / 15-01-7732 / 15-01-1458 / 15-02-6466 / 15-02-7732
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die digitalen Fertigungsmethoden der Architektur an. Der Kurs ermöglicht den Teilnehmenden, mit der Fabrikationsmethoden wie CNC-Laserschneiden, 3D-Drucken und 3D-Scan zu experimentieren, ihre Ideen zu materialisieren und die notwendigen Modellierfertigkeiten zu erlernen. Damit ist Digital Fabrication Basics eine wertvolle Ergänzung zu ENKO V, wo der konstruktive Modellbau gefragt ist. In einer Reihe von Übungen erhalten Teilnehmende eine schrittweise Einführung in die digitale Fabrikation, geometrische Prinzipien und Materialverhalten. Es werden unterschiedliche Prototypen entworfen und gebaut. Grundlegende Kenntnisse von Rhino und Grasshopper werden erwartet oder müssen eigenständig erarbeitet werden.
Zeit: Di, 09:50 – 11:30 h
Erstes Treffen: 14.10.2025
Ort: online
Kontakt: Oliver Tessmann / Iyad Ghazal
Sprache: Englisch


Bachelor / Master
15-01-0354 / 15-01-6464 / 15-01-7730 / 15-02-6464 / 15-02-7730
In dem Seminar wird die Herangehensweise bei virtuellen Rekonstruktionen von zerstörter Architektur vermittelt. Die Studierenden lernen die professionelle Visualisierungssoftware 3ds Max kennen.
Themen des Seminars sind unter anderem Synagogen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die in der NS-Zeit zerstört wurden.
Eine durchgängige Bearbeitung von Bachelor- und Masterseminaren ist belegbar.
Zeit: Di, 09:50 – 11:30 h
Erstes Treffen: 14.10.2025
Ort: L3/01 EG Raum 51 (Fachbereichssaal)
Kontakt: Oliver Tessmann / Marc Grellert
Sprache: Deutsch


Master
15-02-6466 / 15-02-7731
Dieses Seminar untersucht, wie Roboter nicht nur Befehle befolgen, sondern auch sehen, hören und handeln können – ein Ansatz, der als Vision–Language–Action bekannt ist. Zu diesem Zweck haben wir eine digitale Toolchain entwickelt, die die Fähigkeiten von zwei UR10-Robotern um Bildverarbeitung, Sprachinteraktion und Bewegungssteuerung erweitert. Mit dieser Konfiguration können die Studierenden direkt mit den Robotern sprechen, Designideen beschreiben und deren Antworten in Form von Text, Sprache oder physischen Aktionen erhalten. Ein Roboter könnte beispielsweise Variationen einer verbalen Idee skizzieren, verschiedene Montagesequenzen für modulare Blöcke testen oder neue Montagewege durch Drehen, Schieben oder Versetzen von Teilen ausprobieren.
Die Toolchain basiert auf COMFYUI – einer visuellen Plattform, mit der Designer Workflows für verschiedene Aufgaben mit Bildern, Audio, Video oder 3D-Modellen erstellen können. Diese Workflows werden durch vortrainierte KI-Modelle unterstützt, ohne dass komplexe Programmierung erforderlich ist. Der Kurs verläuft Schritt für Schritt: In den ersten Sitzungen werden COMFYUI und Rhino/Grasshopper vorgestellt, gefolgt von interaktiven Experimenten mit Robotern. Aufbauend auf diesen Erfahrungen entwerfen die Teilnehmer ihre eigenen Themen und gestalten die abschließenden Gruppenprojekte.
Im Mittelpunkt des Seminars steht innovatives Denken: Wie können neue Muster, Methoden und Strategien entstehen, wenn Roboter nicht nur als Maschinen, sondern als Partner im Designprozess betrachtet werden? Als Designer werden Sie dazu ermutigt, sich in diesen Dialog einzubringen – indem Sie die Werkzeuge nicht nur zur Erzielung von Ergebnissen einsetzen, sondern kritisch überdenken, wie die Interaktion zwischen Mensch und Roboter unsere Art zu denken, zu entwerfen und zu bauen verändern kann.
Zeit: Do, 15:00 – 17:00 h
Erstes Treffen: 16.10.2025
Ort: L3/01 EG Raum 50 und 51 (Weißer Pool und Fachbereichssaal)
Kontakt: Oliver Tessmann / Yuxi Liu
Sprache: Englisch
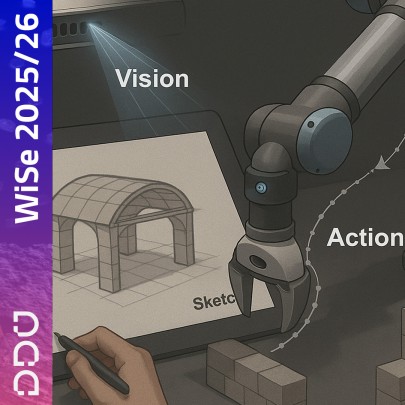
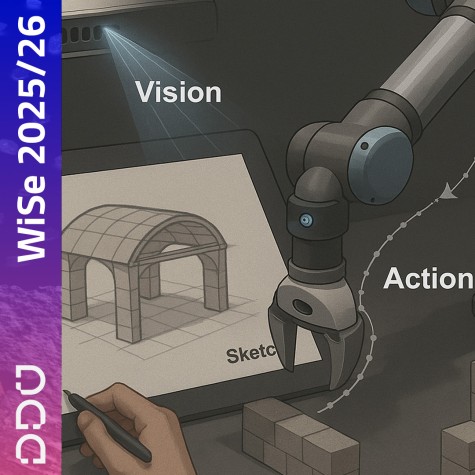
Vergangene Entwürfe
DDU Design Studio 3D gedruckte, adaptive Architekturen
Lehmkonstruktionen sind seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil der Architektur und bieten eine lokal gewonnene, kohlenstoffarme und thermisch effiziente Lösung für Gebäudehüllen. Der 3D-Druck von Lehm birgt das Potenzial, das Material für eine zeitgemäße, leistungsstarke Architektur einzusetzen. Dieses Studio erforscht die architektonischen und räumlichen Qualitäten von 3D-gedruckten Tonmodulen. Studierende werden einen anpassungsfähigen, modularen Fassadenprototyp herstellen, der urbane Landwirtschaft, Wasserregulierung und klimaregulierende Gestaltung einbezieht.
Mithilfe von parametrischen und performanz-orientierten Entwurfsmethoden werden die Studierenden thermische, strukturelle und umweltrelevante Eigenschaften erforschen und dabei computerbasierte Methoden einsetzen. Das Projekt stellt die Teilnehmenden vor die Herausforderung, mikroklimatische Reaktionen, geometrische Rahmenbedingungen und landwirtschaftliche Schnittstellen in Einklang zu bringen und schließlich einen funktionalen Prototyp zu erstellen, der Experimente mit verschiedenen Pflanzen und Strategien für die Fassadenmontage beinhaltet. Während des Kurses erhalten die Studierenden eine Einführung in computerbasiertem Entwerfen, 3D-Tondruck und Urban Farming-Konzepten.
Im botanischen Garten der TU Darmstadt steht dieses Jahr nach der selten auftretenden Blüte eine große Anzahl an Bambushalmen zur Verfügung.
Im Entwurf werden die Teilnehmenden zusammen mit Studierenden des Bauingenieurwesens (Prof. Knaack) eine schattenspendende Dachstruktur entwerfen, die (im Sommersemester 25) gebaut werden soll. Die Gruppenarbeit umfasst Ernte, Trocknung, baukonstruktive Detaillierung und erste gebaute Prototypen dieses natürlichen Hochleistungsmaterials. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung auf dem Campus der TU Darmstadt gezeigt.
In Einzelarbeiten entwerfen die Architekturstudierenden auf Basis dieser technischen und materialspezifischen Kenntnisse städtische Interventionen für Veranstaltungen im Rahmen des World Design Capital Frankfurt. Dabei sollen neben Dächern auch Innenräume entstehen. Im Entwurf kommen digitale Technologien zum Einsatz, um mit dem natürlichen und unregelmäßigen Material präzise arbeiten zu können. Geplant ist das 3-D Scannen der Halme sowie das Erstellen von 3-D gedruckten Verbindungsdetails. Mit computerbasierten Entwurfsmethoden und in Simulation soll die Leistungsfähigkeit des Materials erforscht und für den Entwurf optimal genutzt.
Vergangene Seminare
Ziel des Kurses ist es, die Studierenden mit den Werkzeugen und Methoden des Computational Designs vertraut zu machen. Die Studierenden werden in 3D-Modellierungstechniken mit Rhinoceros, parametrisches und algorithmisches Design mit Grasshopper und Scripting mit Python eingeführt.
In dem Seminar wird die Herangehensweise bei virtuellen Rekonstruktionen von zerstörter Architektur vermittelt. Die Studierenden lernen die professionelle Visualisierungssoftware 3ds Max kennen.
Themen des Seminars sind unter anderem Synagogen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die in der NS-Zeit zerstört wurden.
Dieses Seminar bietet praktische Erfahrungen mit dem robotergestützten Entwurf und der Montage rekonfigurierbarer architektonischer Strukturen. Ein methodischer Rahmen führt die Teilnehmer zum Verständnis des gesamten Arbeitsablaufs für den diskreten Entwurf und die robotergestützte Montageplanung. Anstatt bei Null anzufangen, werden die Studenten mit vordefinierten Montageaufgaben arbeiten, die eine Reihe von Standardteilen (z. B. Stöcke, Plastikflaschen, Blöcke), entwickelte Verbindungstypen und verschiedene kombinatorische Konfigurationen umfassen.
Die wöchentlichen Sitzungen konzentrieren sich auf das robotergerechte Design und die Optimierung der vorgegebenen Baugruppen durch Rapid Prototyping, Robotersimulation und reale Experimente. Die Studenten werden geometrische Merkmale verfeinern, um die Kompatibilität mit Robotergreifern zu gewährleisten und die Toleranzen für die Robotermanipulation zu bestimmen. Darüber hinaus werden sie Montagesequenzen und -pfade sowie die strukturelle Stabilität analysieren und Strategien für die Materialzufuhr, die Entnahme durch Roboter und die Platzierung entwickeln, um die Gesamteffizienz der Montage zu verbessern.
Alle Konstruktionsverfeinerungen, physischen Montageversuche und Roboterausführungsprozesse werden systematisch durch Zeichnungen, Diagramme, Bilder und Videos dokumentiert, um eine umfassende Aufzeichnung der Experimente, Herausforderungen und Optimierungen zu gewährleisten.
Die Fachgebiete Architekturtheorie und -wissenschaft (ATW) und Digital Design Unit (DDU) bieten ein Seminar zum Verhältnis von Menschen und Maschinen in der Architektur gemeinsam an.
Seit es Werkzeuge gibt, regt das Verhältnis von Mensch und Maschine die menschliche Fantasie an, zunehmend maschinell unterstützt. Mit der Digitalisierung vergrößert, vervielfältigt und verschmilzt ihr Grenzbereich fortschreitend und greift in alle Lebensbereiche hinein, aufgeladen mit vielerlei mythischen Vorstellungen. Auch in der Architektur arbeiten Menschen und Maschinen tagtäglich Hand in Hand – ihre Beziehung zueinander lässt sich an digitalgestützten Schreibtischen, Werkstätten und Baustellen beobachten. Ihre Schnittstellen funktionieren meist reziprok, wie beim Einspeisen von menschlichen Informationen in die Architekturmaschine (BIM) oder beim Implantieren bzw. Anheften maschineller Einheiten an Bauwerke oder menschliche Körper (Sensorik). Maschinelles Lernen und generative KI verändern die Mensch-Maschine Kooperation bereits heute. Diesem Prozess liegen digitale Trainings- und Weltmodelle zugrunde, deren Algorithmen oft unzugänglich sind. Vermeintlich dem Menschen vorbehaltene kreative Prozesse und das autonome Agieren in komplexen Kontexten werden zunehmend von Maschinen übernommen.
Im Seminar möchten wir die als technische Innovation verstandenen Werkzeuge im Prozess des Architekturschaffens kritisch reflektieren. Es soll ausgelotet werden, welche Freiheiten der architekturschaffende Mensch im Prozess der Digitalisierung gewinnt und welche Beschränkungen der Mensch durch die Maschine erfährt.
Das Seminar ist als Experimentierfeld gedacht, wo Theorie und Praxis zueinander finden und die Studierenden dahingehend ihren eigenen Schwerpunkt setzen können.
Der theoretische Bezugsrahmen umfasst sowohl klassische Referenzen, z. B. Gilbert Simondon Die Existenzweise technischer Objekte (1958) und Lewis Mumford, The Myth of the Machine (1967/70), stellt aber auch Bezüge zur feministischen Technikphilosophie her, vertreten von Autor:innen wie Donna Haraway, Rosi Braidotti, Caroline Criado-Perez, Catherine d’Ignazio und Lauren F. Klein, Lucy Suchman oder Judy Wajcmann.
Der praktische Anteil umfasst das Erarbeiten eigener Mensch-Maschine-Modelle, bei der Sensoren die physische Umwelt wahrnehmen, die daraus resultierenden Daten verarbeiten und schließlich mittels Aktuatoren mit der physischen Welt interagieren
Das Seminar „Bespoke Bamboo Prototype“ knüpft an die im Bespoke Bamboo Studio (WiSe 24/25) gewonnenen Erkenntnisse an und führt zu einem Design-to-Build-Projekt mit einem 1:1 Demonstrator aus lokal geerntetem Bambus. Im Fokus steht ein durchgängiger digitaler Workflow: Von der algorithmischen und parametrischen Modellierung über die Vorfertigung mithilfe digitaler Fabrikation bis zum finalen Zusammenbau vor Ort. Die Teilnehmenden vertiefen dabei nicht nur ihre Kenntnisse in computergestütztem Entwurf und Konstruktionsmethoden, sondern entwickeln auch ein grundlegendes Verständnis für das natürliche Hochleistungsmaterial Bambus. Durch die praktische Umsetzung sammeln sie wertvolle Erfahrungen im gesamten Entwurfs-, Planungs- und Bauprozess und leisten zugleich einen Beitrag zur Erprobung nachhaltiger Bauweisen.
Verlorene Architektur mittels 3D-Rekonstruktion wieder zum Leben zu erwecken, ist eine Aufgabe des Fachgebiets Digitales Gestalten seit fast 30 Jahren. Die Technologie der Virtual Reality (VR) hat diesem Thema eine neue Präsentationsform gegeben, welche näher an das originale Raumgefühl herankommt, als es jedes andere Medium bisher ermöglichte.
Aufgabe des Blockseminars wird es sein, für das Vermittlungsmedium VR kreative neue Ideen für die Vermittlung verlorener Architekturräume zu entwickeln. Darstellung von historischen Quellen, 3D-Rekonstruktionen und Emotionalität der Inhalte wird hierbei Thema sein.
Die entwickelten Konzepte sollen partiell mithilfe entsprechender Game Engines in VR umgesetzt werden. Eine Kurzschulung in den jeweiligen Tools ist daher Teil des Blockseminars.
Vorerfahrungen in 3D-Rekonstruktion oder Virtual Reality ist wünschenswert, aber keine Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Vorlesung bietet eine Einführung in die wichtigsten digitalen Werkzeuge und Methoden sowie deren Anwendung beim Entwerfen, Darstellen und im Modellbauen. Es werden Beispiele zur effektiven Nutzung digitaler Prozesse und Schnittstellen im Entwurf und Gestaltung diskutiert. Ein besonderer Fokus wird auf das Erlernen von Prozessen gerichtet: Wie greifen verschiedene Werkzeuge ineinander? Welche Schnittstellen gibt es zwischen ihnen? Welchen Einfluss hat das Werkzeug auf das Entwurfsergebnis? Wie können die zeitgenössischen digitalen Werkzeuge und Methoden historisch verortet werden?
In der Übung erlernen Teilnehmer:innen, Zeichnungen und 3D-Modelle zu erstellen, axonometrische und perspektivische Vektorgrafiken aus 3D-Modellen abzuleiten und illustrativ zu bearbeiten, Prinzipien des parametrischen Entwerfens sowie Datenaufbereitung für den Modellbau mittels digitaler Fabrikation (3D-Druck und Laserschneiden). Das Modul befähigt Teilnehmer:innen somit, Digitale Prozesse und Schnittstellen in Entwurf und Gestaltung effektiv zu nutzen.
Das Seminar befasst sich mit robotergestützter Konstruktion und Montageautomatisierung im Bereich der Vorfertigung und des modularen Bauens. Die Studierenden werden in Robotertechniken eingeführt und erforschen die Möglichkeiten, Grenzen und Herausforderungen des Einsatzes vorprogrammierter Roboter für die Montage verschiedener Gebäudestrukturen.
Im Laufe des Semesters werden die Studierenden physische Demonstratoren entwickeln, einschließlich grundlegender Bauelemente, Verbindungsmethoden und deren kombinatorisches Design. Gleichzeitig lernen sie, UR10 6-Achsen-Roboterarme mit Rhino und Grasshopper zu programmieren und die Sequenzen, Pfade und Bewegungen des Roboters sowohl durch Simulation als auch durch den physischen Betrieb des Roboteraufbaus zu optimieren.
Am Ende des Seminars dokumentieren die Studierenden den Robotermontageprozess von physischen Demonstratoren, bewerten kritisch ihre Ergebnisse und schlagen potenzielle Methoden für weitere Verbesserungen vor.
In dem Seminar wird die Herangehensweise bei virtuellen Rekonstruktionen von zerstörter Architektur vermittelt. Die Studierenden lernen die professionelle Visualisierungssoftware 3ds Max kennen.
Themen des Seminars sind unter anderem Synagogen aus dem Rhein-Main-Gebiet, die in der NS-Zeit zerstört wurden.
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die digitalen Fertigungsmethoden der Architektur an. Der Kurs ermöglicht den Teilnehmenden, mit der Fabrikationsmethoden wie CNC-Laserschneiden, 3D-Drucken und 3D-Scan zu experimentieren, ihre Ideen zu materialisieren und die notwendigen Modellierfertigkeiten zu erlernen. Damit ist Digital Fabrication Basics eine wertvolle Ergänzung zu ENKO V, wo der konstruktive Modellbau gefragt ist. In einer Reihe von Übungen erhalten Teilnehmende eine schrittweise Einführung in die digitale Fabrikation, geometrische Prinzipien und Materialverhalten. Es werden unterschiedliche Prototypen entworfen und gebaut. Grundlegende Kenntnisse von Rhino und Grasshopper werden erwartet oder müssen eigenständig erarbeitet werden.



