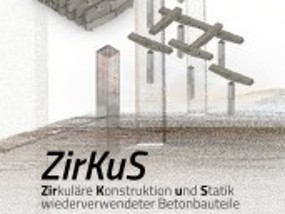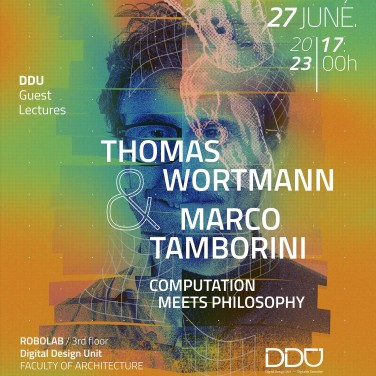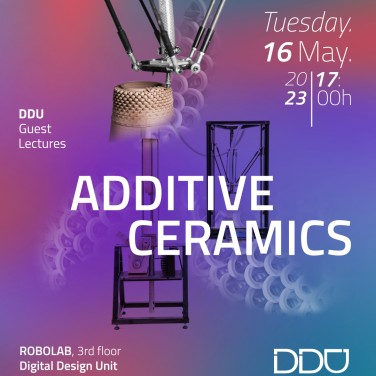-
![]()
![]()
ZirKuS Projektstart
12.11.2025
DDU startet neues Forschungsprojekt „ZirKuS“, gefördert durch die DBU
-
![Liberale Synagoge in der Friedrichstrasse in Darmstadt.]() Bild: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Digitales Gestalten
Bild: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Digitales Gestalten![Liberale Synagoge in der Friedrichstrasse in Darmstadt.]() Bild: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Digitales Gestalten
Bild: Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Digitales GestaltenDigital rekonstruierte Synagogen als Ort der Erinnerung
11.11.2025
Webseite zeigt mehr als 40 zerstörte jüdische Gotteshäuser – Start am 9. November
Zerstörte Synagogen in alter Schönheit: Mehr als 40 jüdische Gotteshäuser sind ab 9. November unter https://virtuelle-synagogen.de virtuell zu erkunden und zu bewundern. Der neue Webauftritt zeigt erstmalig einen Überblick zu Rekonstruktionen von Synagogen, die seit mehr als 30 Jahren am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt entstehen. Abrufbar sind Bilder, Filme und Panoramen von den virtuellen Modellen sowie Informationen zu den ehemaligen Synagogen. Schwerpunkt sind jüdische Gotteshäuser, die von den Nazis 1938 zerstört wurden.
-
![]()
![]()
BE-AM 2025
16.10.2025
Besuchen Sie die BE-AM Ausstellung vom 18. bis 21. November auf der Formnext und nehmen Sie am BE-AM Symposium am 19. November vor Ort oder digital per Livestream teil.
-
![]()
![]()
Vortrag Oliver Tessmann – Plan A Networks
16.10.2025
Oliver Tessmann spricht am 16.10.2025 im Rahmen von plan A Networks über die wichtigsten Forschungsfelder rund um Generative KI und Machine Learning.
-
![]()
![]()
Willkommen Isabelle Gogolok
01.10.2025
Das Fachgebiet DDU begrüßt Isabelle Gogolok als neue wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit der digitalen Rekonstruktion und Visualisierung zerstörter Synagogen in Hessen. Isabelle machte 2025 ihren Master of Science in Architektur an der TU Darmstadt. Schon während des Studiums begeisterte sie sich für digitale Hilfsmittel zum parametrischen Design, der 3D-Modellierung und Visualisierung in Form von Renderings. Praktische Erfahrungen in der Forschung konnte sie als Studentische Hilfskraft, unter anderem bei DDU, sammeln.
-
![]()
![]()
DDU präsentiert neue Rekonstruktion der Eberstädter Synagoge
19.09.2025
F.A.Z berichtet
Bei einer Gedenkveranstaltung in Darmstadt-Eberstadt wurde ein Modell der 1938 zerstörten Synagoge vorgestellt. Grundlage dafür war eine digitale Rekonstruktion, die im Rahmen eines Forschungsprojekts unter der Federführung Marc Grellerts an der Technischen Universität Darmstadt entstanden ist. Das Modell aus Edelstahl offenbart dem Betrachter nicht nur das Äußere der Synagoge, sondern gibt auch einen Einblick in den Innenraum. Ab 2027 soll es im renovierten Eberstädter Rathaus ausgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie in dem in der F.A.Z erschienen Artikel.
-
![]()
![]()
Endless Fungi – Mycelium Composites: Bridging Architecture and Agriculture with Bio-Modules for Sustainable Design
14.09.2025
Masterthesis SS25: Jiaxian Peng
Dieses Projekt schlägt ein geschlossenes System vor, das Pilzzucht mit temporärer Architektur auf Myzelbasis verbindet. Holzzerstörende Pilze wie Austernpilze (Pleurotus ostreatus) und Lingzhi/Reishi (Ganoderma spp.) erfüllen eine doppelte Funktion: Ihre Fruchtkörper werden als Lebensmittel oder Medizin geerntet, während das verbleibende Myzel in wiederverwendbaren 3D-gedruckten oder modularen Schalungen zu Bausteinen gezüchtet wird. Nach der Pilzernte werden diese Myzelblöcke getrocknet und dank einer neuartigen, topologisch ineinandergreifenden Geometrie als Strukturelemente – Bögen, Säulen, Wände – wiederverwendet. Das Moduldesign basiert auf einer Reihe von Drehungen und Spiegelungen, die symmetrische Formen mit nur zwei einzigartigen Oberflächentypen ergeben, sodass sechs ineinandergreifende Formteile hergestellt werden können. Zwei Montagestrategien verbessern die strukturelle Leistungsfähigkeit: ein vorgespanntes System, das elastische Schnüre verwendet, um die Blöcke zusammenzudrücken – und so die Reibung zu erhöhen, ohne das Material zu beschädigen – und ein mit Bambus verstärkter Ansatz, der die schnelle Erneuerbarkeit von Bambus und die geometrische Formbarkeit von Myzel nutzt, um dessen Schwächen in Bezug auf Zug- und Scherfestigkeit auszugleichen. In Zukunft könnte die Automatisierung hängende Anbauanlagen steuern und kontinuierlich Pilze und Myzelziegel produzieren. Gemeinschafts-Kits und gemeinsam genutzte Pavillons würden den Anbau auf Haushaltsebene und temporäre Konstruktionen ermöglichen, während Open-Source-Formen eine weltweite DIY-Beteiligung ermöglichen würden. Ein charakteristischer „Pilzpavillon” veranschaulicht das Konzept: ein solarbetriebener, Regenwasser sammelnder Gemeinschaftstreffpunkt, dessen Fassade aus biologisch abbaubaren Myzelziegeln in einem Bambusrahmen besteht. Da die Außenblöcke biologisch abbaubar sind, können sie nahtlos ersetzt werden und verkörpern so ein regeneratives landwirtschaftlich-architektonisches Ökosystem, das die Nutzer aufklärt und befähigt und gleichzeitig Abfall minimiert.
Fachgebiet Digitales Gestalten
News und Events
News und Events